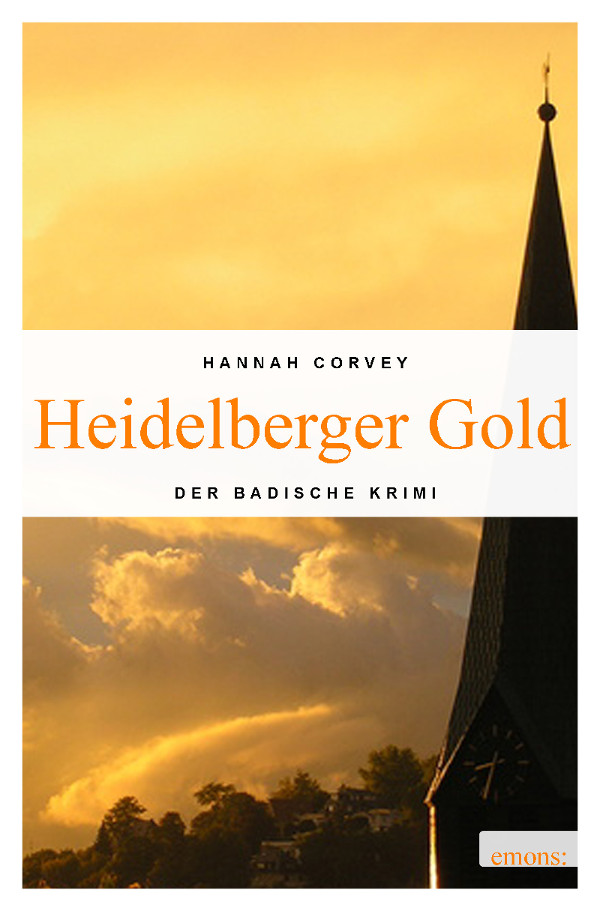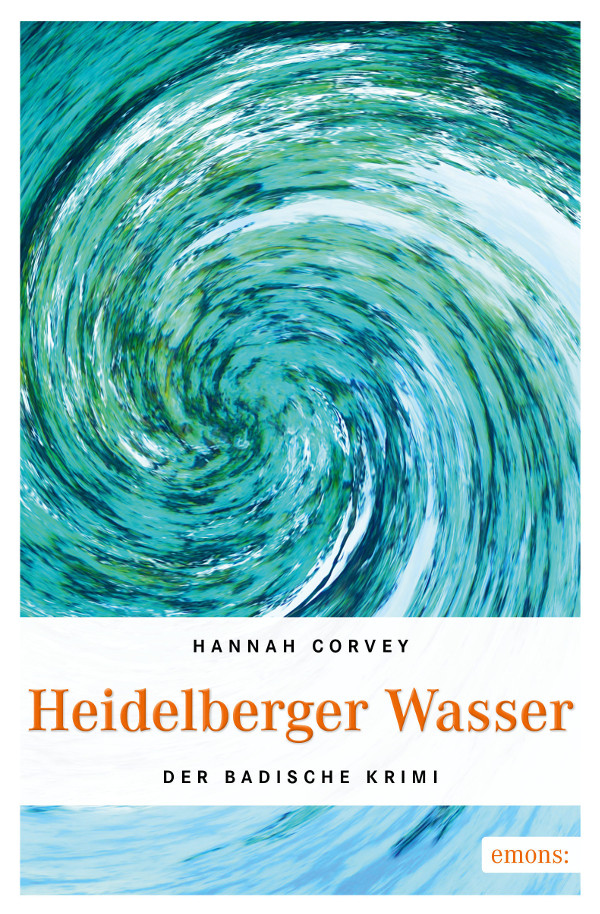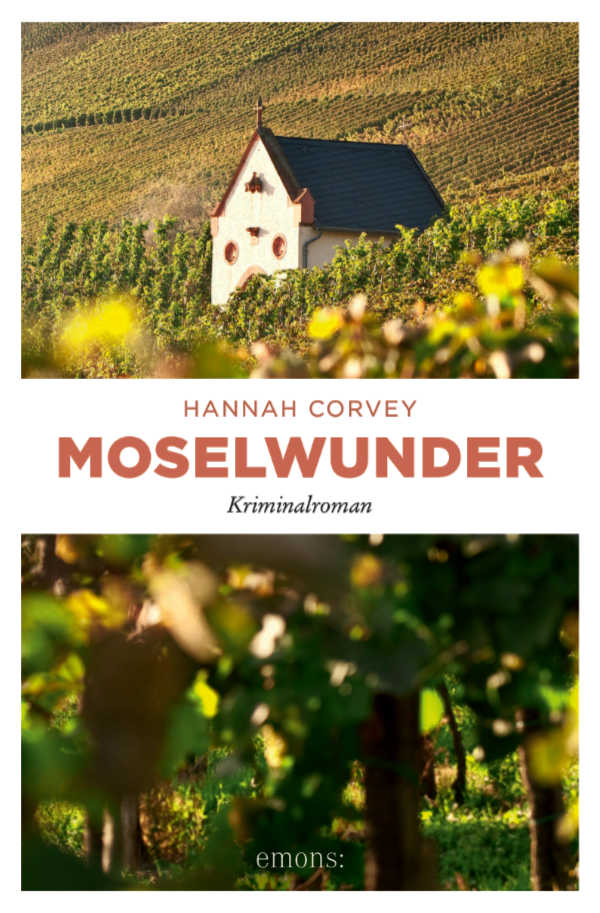Schnell gelesen -
lange nicht vergessen.
Das bisschen Tod uns scheidet …
drei Kurzkrimis als Kindle E-Book – Trennung auf die andere Art hat so ihre Tücken …
Zum Download im Amazon Kindle-Shop ...
Die Schlangenträgerin
Mehr als die Hälfte der Menschen lesen regelmäßig ihr Horoskop, sie glauben, sie seien Fisch, Skorpion, Jungfrau oder Widder. Ausgleichend, temperamentvoll, klug, eigensinnig, im nächsten Jahr mit Geld, Liebe oder guter Gesundheit gesegnet, ...
[weiterlesen]
aber zum Glück auch vorgewarnt: "Passen Sie auf, dass Sie mit ihrem Widder-typischen Optimismus nicht auf die Nase fallen." Oder: "Sie sollten im August nicht die für den Zwilling charakteristische Vogel-Strauß-Politik betreiben."
Ihr Sternzeichen begleitet die Menschen von Geburt an. Die mild lächelnde Hebamme ...
die die Kreißende wissend ansieht: "Ah, ein kleiner Stier." Das goldene Halskettchen der Patentante mit einem Waage-Anhänger, die Fragen schon der Schulkinder untereinander nach dem Sternzeichen, die spätere Partnerwahl, "Was? Löwe und Steinbock? Vergiss es."
Die Menschen färben ihr Selbstbild in den Sternzeichen-typischen Farben. Und sie wissen nichts vom Schlangenträger. Vom unbekannten dreizehnten Sternzeichen, durch das die Sonne ebenso wandert wie durch die anderen zwölf Sternenbilder, sogar länger darin verweilt als im Skorpion.
Man erfährt vom Schlangenträger, wenn man einen kleinen hochbegabten Jungen hat, der sich mit sieben Jahren durch As-tronomie-Bücher liest und am Frühstückstisch verkündet: "Mama, eigentlich bist du Schlangenträger." Mama, eigentlich bist du gar nicht das, was du glaubst zu sein.
Ich glaubte, glücklich zu sein oder zumindest zufrieden.
Noah fragt oft nach seinem Vater, aber sein Vater ist tot. Er ist im Himmel, bei den Sternen. Vielleicht interessiert sich Noah auch deshalb so für Astronomie.
Michael und ich haben vor zwölf Jahren geheiratet, wir kannten uns seit der Schulzeit. Ich wollte immer eine Familie, einen sicheren Hafen, einen Mann an meiner Seite, mit dem ich über die Wogen des Lebens segeln kann, mit dem ich das Schiff gemeinsam steuere. Ohne blinde Passagiere an Bord. Aber vor drei Monaten wurde mir klar, dass wir nicht mehr gemeinsam auf der Kommandobrücke standen, Michael hatte das Steuerrad längst verlassen. Er lag auf dem Bett einer komfortablen Außenkabine, schlürfte eisgekühlten Champagner und vögelte im Rhythmus der Wellen eine andere Frau.
Zuerst waren es nur kleine Dinge, die mein Misstrauen weckten, Michaels spätes Nachhause-Kommen, das er mit seiner Arbeit erklärte, Fahrten ins Büro am Wochenende, eine besondere Aufmerksamkeit Noah gegenüber, immer neue Geschenke. Aber wenn man genau hinsah, was ich eine Weile krampfhaft versuchte zu vermeiden, spürte man, dass ein besonderes Strahlen von Michael ausging, ein Leuchten in seinen Augen, eine Art von Leichtigkeit, ein Schweben über den Dingen.
Ich spionierte in seinem Handy, sie hieß Angelique. Sie wurde sein Todesengel.
Als ich von Michaels Betrug erfuhr, brach meine Welt zusammen, sie zerlief wie ein Aquarell im Regen. Ich konnte nicht mehr klar denken, und eine übermächtige Angst schnürte mir die Kehle zu. Das Fundament meines Lebens ruhte auf Michael, auf unserer Ehe und unserer Familie. Plötzlich lebte ich in einem Gebäude, dessen tönerne Füße jederzeit zerbrechen konnten, alles würde in sich zusammenfallen. Das Entsetzen über den drohenden Verlust hämmerte Tag und Nacht in meinem Kopf, die Angst wurde immer stärker, sie wurde unerträglich. Schließlich zog sie mich in einem Instinkt der Selbsterhaltung hinüber zur Nachsichtigkeit. Ich würde meinem Mann verzeihen können, wenn er seine Affäre beendete und zu mir zurückkehrte, zu uns zurückkehrte. In guten wie in schlechten Tagen, wir würden diese Krise überwinden. Ich würde stark sein, für uns und für unseren Sohn. Aber die Geschichte mit Angelique musste aufhören.
Als Michael an einem kalten Abend im November erst kurz vor Mitternacht nach Hause kam, stellte ich ihn zur Rede. Er stritt alles ab. Ich konfrontierte ihn mit den eindeutigen Nachrichten auf seinem Handy, er sah mich an und gestand dann unter Tränen. Aber es waren keine Tränen der Reue, auch keine der Verzweiflung. Es waren Tränen eines tiefen Gefühls, einer Bewegtheit, vielleicht sogar die einer Erleichterung, einer Befreiung von der Last des Geheimnisses. Er sprach von Liebe, Liebe zu Angelique. Ich war fassungslos und wollte dieses unsäglich dumme Gefühl aus ihm herausschütteln, es gehörte nicht in ihn, es hatte dort keinen Platz, es war in den falschen Mann gefahren. Ich wollte Michaels Verblendung vertreiben, mit Worten und mit Küssen, aber er stieß mich weg. "Das mit uns geht einfach nicht mehr. Nicht, seit ich Angelique kenne." Seine Augen leuchteten, mir wurde übel.
Am nächsten Tag teilte Michael mir mit, dass er ausziehen werde, er wolle ein neues Leben beginnen. Und er wünsche sich, dass Noah die Hälfte der Zeit bei ihnen verbringe, bei ihm und Angelique. Die Worte kamen aus seinem schmutzigen Mund und bohrten sich in mein Herz wie glühende Pfeile. Er wollte mein Kind teilen, es durchtrennen wie ein Puppe, es hin und her zerren, ihm sein Zuhause nehmen, Noah einer fremden Frau geben. Vielleicht würde Angelique noch ein Kind bekommen und Noah würde ganz bei seiner neuen Familie bleiben wollen.
Ich dachte, ich sei eine glücklich verheiratete Frau, ich dachte, ich hätte eine schöne Familie. Ich dachte, ich sei Schütze. Aber ich war Schlangenträgerin. Ist überhaupt etwas wie es scheint?
Die Selbstverständlichkeit, mit der Michael ab nun immer wieder nachts überhaupt nicht nach Hause kam, raubte mir den Schlaf. Die Selbstverständlichkeit, mit der er in den anderen Nächten neben mir im Ehebett lag und schlief, brachte mich zur Raserei. Er hatte über unser Leben und unsere Familie entschieden und ich wurde weggeweht wie ein wertloses Stück Papier im Novemberwind. Zwei Wochen später zog Michael schließlich aus.
Noah litt, er verstand die Welt nicht mehr. "Warum ist Papa weg? Warum will er nicht mehr mit uns leben?"
Er vergrub sich immer tiefer in seine Bücher, kam oft stundenlang nicht aus seinem Zimmer. Einmal beim Abendessen fragte er: "Mama, kennst du die WOZ?"
"Was?"
"Die wahre Ortszeit, die nach dem Stand der Sonne. Wenn Papa jetzt östlich von uns lebt, ist es bei ihm schon später als bei uns."
"Schatz, Papa lebt nur zwanzig Kilometer entfernt."
"Dann ist es vielleicht nur eine Minute später." Noah sah mich fragend an. "Mama, wohin geht die Zeit, die Minute zwischen Papa und uns?"
Es war mehr als eine Minute, zwischen uns lagen Lichtjahre, Michael lebte nicht mehr in der gleichen Zeit wie wir. Er bildete sich ein, er sei sechsundzwanzig und hätte mit seiner jungen Freundin noch das ganze Leben vor sich. Dabei hatte er schon ein Leben, und niemand hier auf dieser Welt bekommt zwei. Die Natur ist gerecht, sie ist gut. Keiner kann die Zeit zurückdrehen, keiner kann ihren Gesetzen entfliehen. Aber wir sind trotz allem gut aufgehoben. Mutter Natur gibt uns ganz wunderbare Dinge, sie gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Sie lässt unter der hellen Sonne das Korn wachsen, die goldenen Äpfel, die Bachforelle im klaren Wasser und das Wildbret auf der taufeuchten Wiese. Sie lässt die Tollkirsche, den Goldregen und die Herbstzeitlose wachsen und hat die Dinge weise und vorausschauend eingerichtet.
(…)
Aus Literamus 41
und als Teil der Kurzkrimisammlung
"Das bisschen Tod uns scheidet …"
drei Kurzkrimis als Kindle E-Book – Zum Download im zum Amazon Kindle-Shop
[weniger anzeigen ...]
Flug 19
Am 5. Dezember 1945 verschwanden über dem Bermudadreieck fünf amerikanische Jagdflugzeuge während eines Trainingsfluges spurlos. Keiner der insgesamt vierzehn Männer an Bord, kein einziges Metallstück, kein noch so kleines Teilchen einer der Maschinen wurde je gefunden.
[weiterlesen]
Ein losgeschicktes Suchflugzeug verschwand ebenfalls auf Nimmerwiedersehen, an der vermuteten Absturzstelle fand sich eine große Öllache – sonst nichts.
Flug 19 schürte die Spekulationen zum Bermudadreieck – wie kann es sein, dass sechs Militärflugzeuge spurlos verschwinden?
Vielleicht regte Flug 19 aber auch die Fantasie des ein oder anderen braven Ehemannes an. Wieso werden ein halbes Dutzend Flugzeuge vom Erdboden verschluckt und die schnarchende Fleischpflanze in der anderen Hälfte des Ehebettes ist immer noch da? Warum tut sich nicht die Erde auf, wenn die Mensch gewordene Enttäuschung morgens ihren Hintern aus den Federn hebt, wenn sie völlig übertrieben in ihrem Getue wie ein Helikopter um die Kinder schwirrt, wenn sie am Herd steht und Eier brät, um ihren Körperumfang weiter sinnlos zu vergrößern?
Gefühle verschwinden täglich spurlos, aber ihnen wird keine Suchmannschaft hinterhergeschickt, höchstens in Einzelfällen ein beflissener, überbezahlter Paartherapeut, der mit seiner eigenen Frau und deren Yoga-Lehrer eine „offene Beziehung“ lebt. „Dietmar, sagen Sie doch mal, was könnte Gabi denn tun, damit Sie sich wieder zu ihr hingezogen fühlen?“ Erfolgschancen? So groß wie die der Bergung von Flug 19.
Ich hatte Doris als junge, strahlende, rotwangige Frau geheiratet, sie war zupackend, unkompliziert und in ihrer Offenheit und Frische durchaus reizvoll. Eine Frau zum Pferdestehlen, ohne unnötige Dramatik, die im Bett war wie ein neu eingesäter Acker, wie dampfende Kartoffelsuppe nach einem langen Arbeitstag, wie eine zuverlässige Dieselmaschine.
Nach der Geburt unseres Sohnes schien unser Glück perfekt. Wenn ich abends aus der Praxis nach Hause kam, schloss ich die Tür mit einem Gefühl von Stolz und Freude auf, aber das ist Lichtjahre her. Dann kam unsere Tochter zur Welt, Doris ging voll und ganz in ihrer Mutterrolle auf, sie kümmerte sich um die Kinder und verabschiedete sich vom letzten Rest ihrer ohnehin wenig ausgeprägten Eitelkeit. Es schien, als ob sie übergangslos ein drittes Kind erwartete, als ob sie dauerschwanger wäre, denn sie verlor kein einziges ihrer Babypfunde. Doris ging zu bequemer Kleidung über, die abends voller Breiflecken war, verzichtete durchweg auf Make-Up und legte sich einen praktischen Kurzhaarschnitt zu.
Das alles widerfährt vielen Männern, die entscheidende Frage ist, ob das Muttertier noch zwischen Mann und Kindern unterscheiden kann. Doris konnte es nicht. Sie redete mit mir wie mit einem Vierjährigen, es machte mich wahnsinnig. Unser Eheleben reduzierte sich auf sporadische Pflichtübungen und einmal, als ich auf ihr lag und mit dem zweifelhaften Gefühl kämpfte, in einem riesigen Marshmallow zu versinken, sagte sie, „ja, komm zu Mami.“ Das war der Abgesang, Doris und Gerd auf dem Beischlaf-Friedhof.
Wir fanden uns fortan in einer Familien-WG wieder, aber Doris schien es noch nicht einmal zu bemerken. Leidenschaft und Liebe waren verschwunden, wir lebten geräuschlos nebeneinander her. Ein paar Jahre lang ging das so. Im Rückblick war dieses spurlose Verschwinden jeder Anziehung geradezu komfortabel und simpel. Doch Verschwinden ist die eine Sache. Die Metamorphose der Gleichgültigkeit in abgrundtiefen Hass die andere.
Der Katalysator dieser Umwandlung, über deren Möglichkeit man sträflicherweise nicht vorgewarnt wird, über die der Standesbeamte schweigt, obwohl er mit der Heiratsurkunde einen Beipackzettel aushändigen sollte über Risiken und Nebenwirkungen, der Katalysator dieser lebensfeindlichen Verwandlung neutral geladener Materie in hochgiftigen Sondermüll war Oksana. Sie trat in mein Leben wie ein züngelndes blaues Flämmchen und zwischen mir und Doris entstand ein dickflüssiger Brei aus Hass und Abscheu.
Oksana kam in meine Praxis, an einem Dienstag im Mai. Nach einer schwierigen Wurzelbehandlung und einer schlecht sitzenden Prothese. Sie war wie eine Erscheinung, ihr Lächeln, ihre strahlenden Augen, ihr dunkles, welliges Haar, ihre langen, makellosen Beine, die sie über den Behandlungsstuhl ausgestreckt hatte.
„Guten Tag Herr Doktor“, das rollende R klang charmant, „ich denke darüber nach, mir einen kleinen Diamanten in den Zahn hier vorne links einsetzen zu lassen“, ihr rotlackierter Zeigefinger wies durch schimmernde, leicht geöffnete Lippen auf den fast reinweißen Zwei-Zweier im Oberkiefer.
Ich war ein Mann, der mit einem Haflinger zusammenlebte und nun saß eine Araberstute vor mir und lächelte mich geheimnisvoll an. Natürlich hatte ich hin und wieder attraktive Patientinnen, aber Oksana war anders, das spürte ich sofort. Sie verkörperte das Leben, das ich hätte führen können, hätte ich mich nicht für Doris entschieden, hätte ich nicht Apfelmost prickelndem Champagner vorgezogen.
Oksana sandte mir eindeutige Signale, ich lud sie zum Essen ein. Die weitere Geschichte ist die eines sehr, sehr durstigen Mannes, der endlich zu einer Quelle kommt. Mit Oksana brach ich auf zu ungeahnten Höhenflügen, erhob mich aus dem verbeulten Blechsitz eines alten Hanomag und stieg in eine Mondrakete. Oksana gab mir alles, wonach ich mich sehnte, sie gurrte „Gerrrd, kein Mann ist wie du“ und zeigte mir das lodernde Feuer in ihrer Seele. Endlich war ich aus meiner Starre erwacht, endlich begann ich wieder zu leben.
Nach ein paar Wochen sagte Oksana: „Gerd, lass uns ganz neu anfangen, nur wir beide.“ Sie sagte: „Gerd, ich kann nicht ewig als deine Mätresse leben, ich bin katholisch erzogen worden“, der rote Schmollmund wurde schmal, „so etwas kommt für mich nicht in Frage.“
Als ich wieder einmal erst kurz vor Mitternacht nach Hause kam, stellte mich Doris zur Rede. Natürlich hatte sie meine Veränderung bemerkt, meine neue Garderobe, mein Strahlen, das späte Nachhausekommen. Ich machte mir nicht die Mühe, sie zu belügen, ich hatte keine Kraft mehr dazu. Und die Aussicht frei zu sein für Oksana war zu verlockend.
Doris blieb kühl, temperamentlos wie ein Kaltblüter. Sie machte nicht viele Worte, aber ich ahnte, dass sie das Wenige, das sie sagte, genauso meinte.
„Bei einer Scheidung werde ich dich finanziell ruinieren und dafür sorgen, dass du die Kinder nicht mehr wiedersiehst.“ Dann drehte sie sich um, ging die Treppe hinauf und legte sich schlafen.
Am darauffolgenden Freitag kam ich von der Arbeit und fand einen Zettel auf dem Esszimmertisch vor:
Bin übers Wochenende mit den Kindern weg, du kommst sicher ohne uns zurecht. Ruf mich nicht an.
Wieso sollte ich auf die Idee kommen, sie anzurufen? Ich öffnete eine Schublade der weiß lasierten Anrichte, ließ den Zettel hineinsegeln, packte ein paar Sachen in eine kleine Reisetasche und fuhr zu Oksana.
Doris würde sich schon wieder beruhigen, sie würde ein Einsehen haben, dass es so mit uns nicht weitergehen konnte, sie würde sich alles noch einmal überlegen und einwilligen in eine einvernehmliche Scheidung.
Aber auch nach ihrer Rückkehr war sie entschlossen und stur wie ein Eifeler Holzrückepferd. Und sie blieb es. „Ich habe zu dem Thema alles gesagt, was es zu sagen gibt. Wenn du dich scheiden lässt, wirst du alles verlieren.“
Ich suchte einen Anwalt auf. Doris hatte durch eine Erbschaft ein beträchtliches Vermögen mit in die Ehe gebracht, meine Praxis und das Haus waren von diesem Geld finanziert. Ich würde die Praxis verkaufen müssen, dazu hatten Doris und die Kinder einen Anspruch auf Unterhalt, der teure Wagen, der Golfclub, kostspielige Urlaube wären passé und vermutlich würde ich sie auch nicht daran hindern können, mit den Kindern wegzuziehen. Am Abend sprach ich mit Oksana darüber.
„Was? Du sollst deine Praxis verkaufen? Aber wovon sollen wir dann leben?“ Ängstlich sah sie mich an.
„Aber Schatz, du hast doch gesagt, wir fangen noch einmal ganz neu an ….“
„Ja, aber doch nicht als arme Leute“, Oksana blickte traurig auf die dunkelrote Bettwäsche. Dann seufzte sie leise: „Gerd, wir wollten doch immer füreinander da sein“, sie schmiegte sich an mich, „und füreinander sorgen.“ Ihre Hand glitt unter die Bettdecke. „Darauf muss ich mich schon verlassen können, weißt du.“
Als Oksana und ich uns liebten stieg vor meinem geistigen Auge ein Torpedobomber über Florida auf, das Wetter war gut, der Himmel blau. Eingeklemmt im Cockpit saß Doris mit einer albernen Lederkappe und einer zu groß geratenen Fliegerbrille. In einer lächerlich wirkenden Geste zeigte sie mit ihrem Daumen nach oben, der Propeller wurde angeworfen. Sie hob ab. Auf Nimmerwiedersehen.
Ich war ein Mann, ich musste die Sache systematisch angehen. Doris musste weg und zwar ganz weg. (…)
Erschienen in Literamus 42
und als Teil der Kurzkrimisammlung
"Das bisschen Tod uns scheidet …"
drei Kurzkrimis als Kindle E-Book – Zum Download im zum Amazon Kindle-Shop
[weniger anzeigen ...]
Kunstscheiß
Sie hatte es gewagt, seine Arbeit als Kunstscheiß zu bezeichnen. Er kannte die Frau nicht und sie kannte ihn nicht, aber wenn sie Augen im Kopf hatte, hätte sie sehen müssen, dass seine Bilder großartig waren. Nina Faller, Kulturredakteurin. Das Blatt erschien in einer Auflage von vierzigtausend Stück, vierzigtausend Mal waren ihre Unverschämtheiten in die Welt geblasen worden, eine Stadt war belogen worden über Walter Haspels Kunst, seine farbstarken, großformatigen Gemälde, Werke eines Ausnahmetalents.
[weiterlesen]
Es gab Kunstschnee und Kunstrasen, es gab keinen Kunstscheiß, vielleicht gab es scheiß Kunst, aber dazu gehörte seine nicht. Nina Faller würde für ihre unsägliche Kritik bezahlen müssen. Er ließ es sich nicht gefallen, von einer dahergelaufenen Journaille in den Dreck geschrieben zu werden.
Mit zitternder Hand goss er sich ein Glas Barolo ein, seine Pupillen zuckten über das Zeitungspapier. „… hat Haspel mit nahezu traumwandlerischer Sicherheit bei seinem Bild Denkers Ruh ein Exempel des Dilettantismus geschaffen, das seinesgleichen sucht. Sollte, wenn der Denker ruht, nicht auch der Pinsel des Meisters ruhen?“
In der Gegend seines Herzens stach ihn etwas, er schüttete den Rotwein die trockene Kehle hinunter.
„Die grünlich verwaschenen Konturen von Morgenlicht erinnern an das trübmilchige Erwachen nach einer durchzechten Nacht, in der man es nicht mehr rechtzeitig zur Toilette geschafft hat. Man möchte das Gewesene schnellstmöglich vergessen, und so möchte man weitergehen und Verstörendes auf Leinwand hinter sich lassen.“
Die Wände seines Ateliers fingen an zu taumeln, für einen Moment wusste er nicht mehr, wo oben und unten war. Helles Sonnenlicht flutete durch die großen Fenster, aber um ihn herum schien es dunkel zu werden. Mit seinen kräftigen Händen, an denen noch Farbreste klebten, rieb er sich durch das Gesicht, über die grau werdenden Bartstoppeln und den sehnigen Hals. Die Präsentation seiner Gemälde im Kulturzentrum der Stadt war seine Chance gewesen, er brauchte ein paar Verkäufe, um weitermachen zu können, weiter malen zu können. Weiter leben zu können. Es ging um seine Existenz.
„Die schmerzhafte Klimax findet Haspels Ausstellung in dem Bild Stangenfieber, die dargestellte Szene ruft beim Betrachter eine merkwürdige Beklommenheit hervor … Abenteuerlich verteilte Farbpigmente fügen sich auf zwei Quadratmetern zu einem Stillleben der Ratlosigkeit … Die Bilder von Drittklässlern hätten womöglich einen vergnüglicheren Nachmittag bereitet.“
Er schleuderte die Zeitung von sich fort in den Raum. Dieser Faller gehörte das Handwerk gelegt. Und zwar gründlich. Vor Zorn bebend stand er auf, ging die paar Schritte hinüber zu seinem Computer und begann zu recherchieren.
Aus "Das bisschen Tod uns scheidet …"
drei Kurzkrimis als Kindle E-Book – Zum Download im zum Amazon Kindle-Shop
[weniger anzeigen ...]